Suche
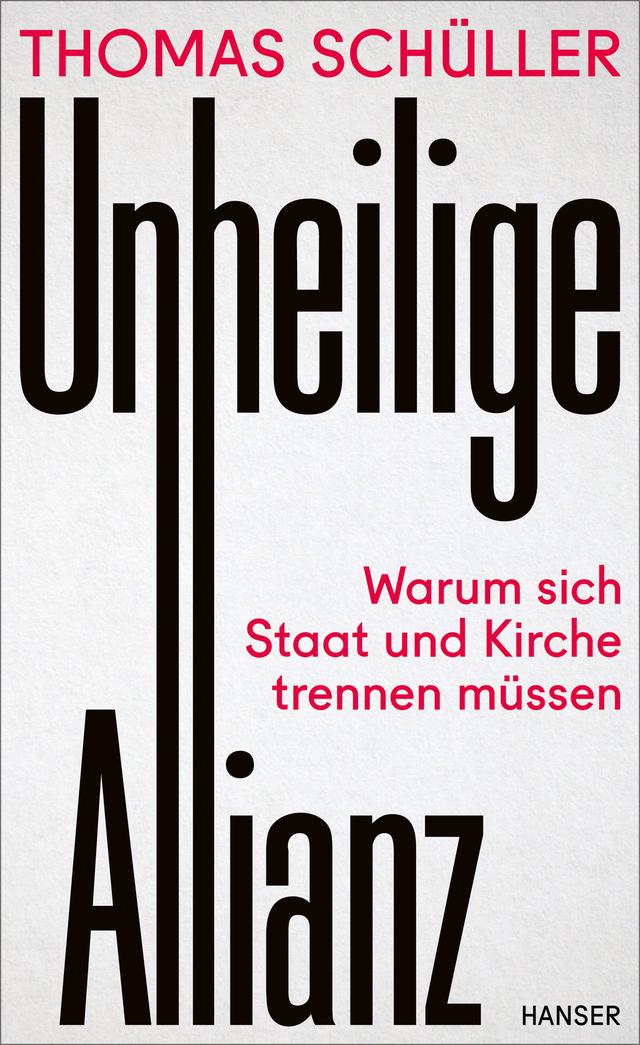
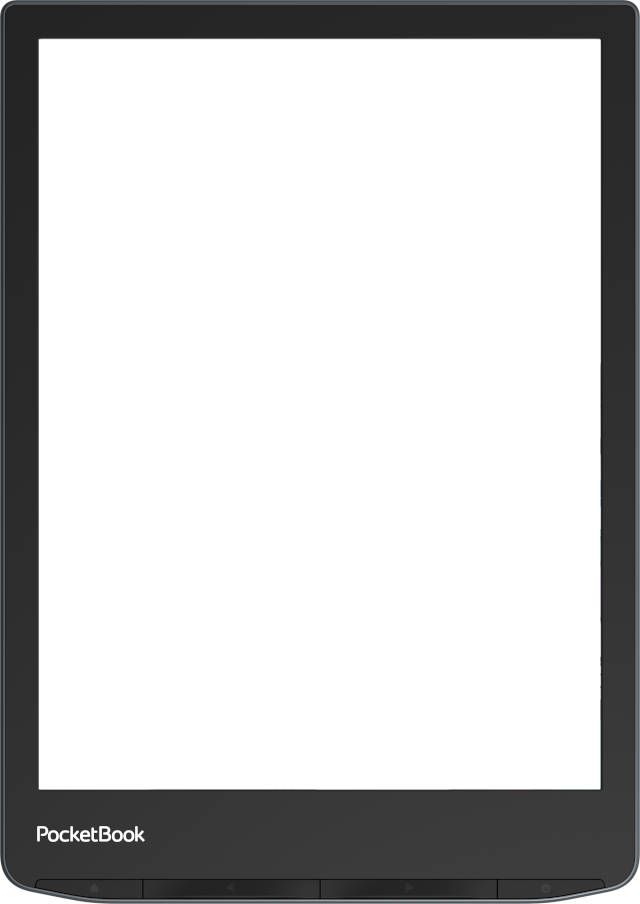
Unheilige Allianz
Warum sich Staat und Kirche trennen müssen | Thomas Schüller
E-Book
2023 Carl Hanser Verlag Gmbh & Co. Kg
Auflage: 1. Auflage
208 Seiten
ISBN: 978-3-446-29772-2
in den Warenkorb
- EPUB sofort downloaden
Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich
Ein prominenter Kirchenrechtler ruft auf: schafft die Privilegien der Kirche ab!
Weniger als die Hälfte der Deutschen gehört noch einer der beiden Kirchen an, die aber verfügen weiterhin über enorme Privilegien. Dem Staat kommt es gelegen, wenn Diakonie und Caritas soziale Aufgaben übernehmen, und sei es auf Kosten des Arbeitsrechts. Sexuellen Missbrauch verfolgt die kirchliche Justiz genauso halbherzig wie Veruntreuung - und die weltliche Justiz schaut zu. Dabei kassieren die Kirchen jedes Jahr eine halbe Milliarde Euro staatlicher Steuergelder, weil vor 200 Jahren ihre Klöster enteignet wurden. Für Thomas Schüller, führender Kirchenrechtler und streitbarer Kopf, profitieren beide Seiten von dieser Komplizenschaft. Aber die Gesellschaft hat sich verändert: höchste Zeit, dass dieser unheiligen Allianz ein Ende gemacht wird.
Thomas Schüller, Jahrgang 1961, studierte in Tübingen, Innsbruck und Bonn Katholische Theologie. Seit 2009 ist er Professor für kanonisches Recht an der Universität Münster. Bekannt wurde er durch seine kritischen Stellungnahmen zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche, zu den Kontroversen um den Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki sowie zu den Auseinandersetzungen über die Anliegen des sog. 'Synodalen Wegs'. Er ist ein regelmäßiger Gesprächspartner und Beiträger für führende überregionale Medien.
Beschreibung für Leser
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
Es steht nicht gut um die beiden ehemals großen Kirchen. Nur noch knapp unter 50 Prozent der Bevölkerung gehören ihnen an, Tendenz stark abnehmend. Immer weniger Kinder werden getauft, immer mehr Kirchenmitglieder treten aus, und die älteren Gläubigen sterben. Und dann auch noch das: Missbrauchsskandale und finanzielle Vetternwirtschaft, wie von Bischof Tebartz-van Elst in Limburg oder Bischof Hanke in Eichstätt praktiziert, führen zumindest für die katholische Kirche zu einem Vertrauensverlust nicht geahnten Ausmaßes. Im Ansehen der Bevölkerung rangiert sie inzwischen hinter der schon unbeliebten Versicherungsbranche. Auch der charismatisch gestartete und zunächst medial gehypte Papst Franziskus musste Federn lassen und führt sein Amt inzwischen nicht mehr unangefochten. Der mit viel Hoffnung gestartete Reformprozess des »Synodalen Weges«, eine Antwort auf die erkannten systemischen Ursachen für den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, endet vor den römischen Mauern, obwohl seine zarten Reformversuche im Bereich der Sexualmoral oder die Forderung nach einer auch nur symbolischen Beteiligung von Gläubigen an kirchlichen Leitungsentscheidungen wenig spektakulär erscheinen. Aber selbst kleinste Reformschritte werden sofort zurückgepfiffen. Für viele Beobachter der katholischen Kirche wirkt sie mit ihrem Mindset wie aus der Zeit gefallen. Die innerkirchlichen Polarisierungen zwischen den verschiedenen Blasen vom ganz rechten Rand - und dies darf durchaus auch allgemeinpolitisch verstanden werden - bis zu den Reformern lähmt die katholische Kirche, lässt sie wie in einem Stellungskrieg erstarrt und tot erscheinen.
Doch Totgesagte leben länger. Politische Entscheidungsträger lassen es sich weiterhin nicht nehmen, die Sternsinger Anfang des Jahres zu empfangen, um mit anrührenden Bildern der Öffentlichkeit zu demonstrieren, dass die Kirchen doch Gutes für die Gesellschaft und für die Kinder dieser Welt bewirken. Und selbst wenn sich Politiker:innen nicht mehr mit dem in die Kritik geratenen Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki ablichten lassen, fehlt doch bei keiner Eröffnung einer neuen Legislaturperiode des Deutschen Bundestags die ökumenische Andacht, bei der Vertreter:innen der beiden Kirchen die Abgeordneten und die Regierungsmitglieder geistlich auf eine dem Gemeinwohl verpflichtete Politik einschwören. Beide Büros der Kirchen in Berlin leisten bis heute eine diskrete, in Teilen immer noch wirkmächtige Lobbyarbeit für die kirchlichen Interessen. Doch halt: Kommen da nicht von der aktuellen Regierung unmissverständliche Signale der deutlichen Distanz zu den Kirchen? Während der langen Regierungszeit Angela Merkels gehörte es zum guten Ton der Berliner Politik, dass die Spitzen der Regierung und Opposition zum Michaelsempfang der katholischen Kirche kamen, um den Worten des weltgewandten Mainzer Kardinals Karl Lehmann zu lauschen. Diese Zeiten scheinen unwiderruflich vorbei: Beim letzten Empfang sah man zwar den Katholiken und Oppositionsführer Friedrich Merz, ansonsten aber nur die dritte und vierte Garnitur der Parteien, jedoch nicht den Kanzler oder ein Kabinettsmitglied, um dem gutmütigen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing aus Limburg zuzuhören. Zeigt sich hier eine Entfremdung der herrschenden politischen Klasse von den beiden Kirchen, die man nicht mehr für gesellschaftlich relevant betrachtet? Ein Indiz könnte auch der aktuelle Koalitionsvertrag sein, der den Kirchen nur wenige Zeilen widmet, um anzukündigen, kirchliche Sonderrechte im Arbeitsrecht zu streichen. In der Tat: Konnte es sich ein Kanzler Kohl in Zeiten von Kardinal Höffner und Kanzlerin Merkel in Zeiten von Kardinal Lehmann einfach nicht leisten, sich in grundlegenden Fragen wie dem Schutz des ungeborenen Lebens oder der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe gegen
