Suche

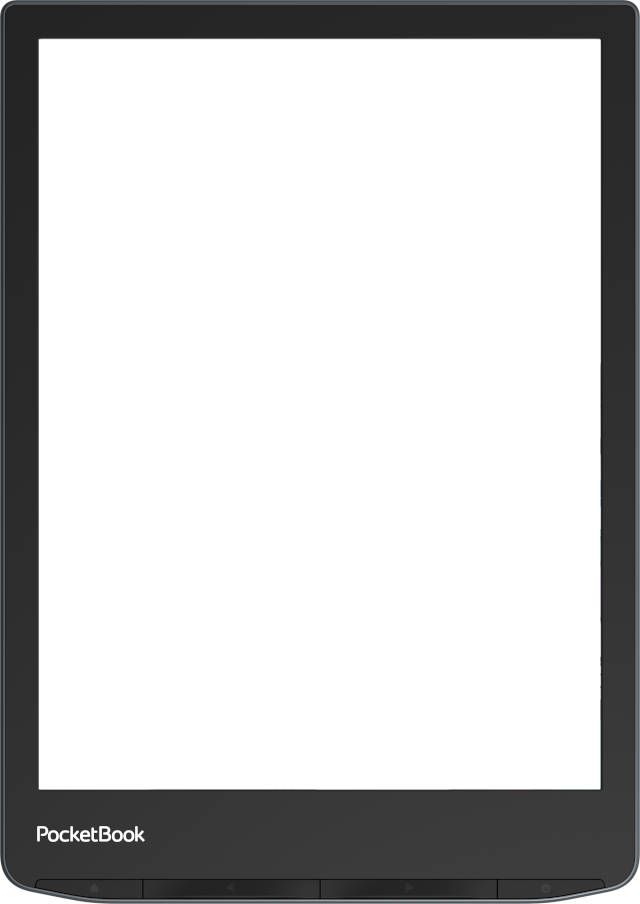
Wäre da doch jemand, der mich hört!
Wege durch Zeiten des Leids | Thomas Weiß
E-Book
2024 Gütersloher Verlagshaus
192 Seiten
ISBN: 978-3-641-29000-9
in den Warenkorb
- EPUB sofort downloaden
Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich
Hilfe für alle, die in schwierigen Situationen nicht mehr weiterwissen
Wo ist Gott, wenn es im Leben so richtig schlecht läuft? Als Seelsorger hat Thomas Weiß oft versucht, mit betroffenen Menschen Antworten auf diese Frage zu finden. Als ihn selbst die Not trifft und eine Krankheit sein Leben bedroht, wird ihm, was er gesagt und sich zurechtgelegt hat, schal. Gott rückt ihm fern. Findet er in seiner Angst noch Gehör bei dem, auf den er bisher vertraut hat? Er zweifelt, aber er will diesen Gott nicht loslassen.
Die Meditationen, Gedichte, kleinen Geschichten und Essays dieses Buches sind Zeugnisse dieses Ringens. Sie zeigen: In der Angst kann gerade der Zweifel an der Nähe Gottes die Art des Glaubens sein, die durch die Not hindurchträgt. Ein Buch, das den schweren Fragen des Lebens nicht ausweicht und gerade darum tröstet und hilft.
Thomas Weiß, geb. 1961, Studium der Evangelischen Theologie in Bielefeld und Heidelberg, danach Arbeit in Gemeinden Süd- und Nordbadens und als Erwachsenenbildner in Freiburg. Mitglied der Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik, Leipzig, Stipendiat und Mitglied des Förderkreises deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg, Stuttgart. Derzeit arbeitet er als Leiter der evangelischen Erwachsenenbildung in der Badischen Landeskirche (Landesstelle für evang. Erwachsenen- und Familienbildung, Karlsruhe). 2020 wurde er in das PEN-Zentrum Deutschland aufgenommen. Thomas Weiß lebt in Baden-Baden.
Beschreibung für Leser
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
Und - fehlt er Ihnen?
Ich finde diese Frage nicht leicht zu beantworten. Natürlich fehlt mir einer, der mir die Welt erklären kann, der am Ende alles zum Guten wendet, auf den ich mich verlassen kann, wenn der Atem knapp wird und mir die Luft ausgeht. Es ließe sich leichter leben so. Wenngleich den Verlegenheiten, die das Leben bereithält - Michael Krüger spricht von der Sehnsucht nach Trost und von der Scham, überhaupt da zu sein -, nicht abgeholfen wird. Ob er da ist oder nicht. Gott federt das ab, macht es erträglicher, aber dass mein Leben unvollkommen, gebrochen, gezeichnet und gefährdet ist, daran ändert sein erhofftes, gefühltes oder postuliertes Dasein nichts. Es lässt sich nur leichter überspielen: Ich finde Worte dafür in alten Gebeten oder neuen Liedern. Mir tun sich Räume der Stille auf, in denen ich mich beruhigen kann. Ich habe einen, den ich anrufen oder anschreien kann, wenn mir nach Klagen und Rechten ist. Das ist nicht wenig. Doch ist es schon alles?
Fehlt er mir, weil ich es gerne erträglicher hätte? Damit meine schmerzliche Sehnsucht einen Ort hat, wohin sie sich wenden kann? Damit ich mir meine Fragen nicht alle selbst beantworten muss? Damit Antworten von einer Autorität kommen, die nicht ständig in Frage steht?
Anderen fehlt er, weiß das Gedicht. Zu denen gehöre ich wohl, auch wenn ich mir der Gründe meiner Mangelerfahrung nicht sicher bin. Es könnte sein, dass er mir fehlt, weil ich einen Gott brauche, weil ich - im Bild gesprochen - ohne die göttliche Krücke2 nicht gehen kann. Weil mir ein Gott sehr recht wäre. Einer, der mir dies und das abnimmt, für das ich zu kraftlos und mutlos - oder zu unmotiviert und faul - bin. Einer, der mich kennt und aushält. Ein Gott, der den Horizont weitet, so dass ich nicht allein auf die Weite meiner Erkenntnis (die nicht sehr weit ist) und die Grenzen meiner Angst (die eng sind) gewiesen bin. Ein Gott, der für eine Zukunft der Menschen und der Welt steht, an die zu glauben mir kaum noch möglich ist. Er braucht keinen besonderen Namen und keine Titel haben, keine besondere Persönlichkeit auch, dieser Gott. Wichtig ist, dass er mir aufhilft, dass er mir nützt. Solch einen Gott kann ich brauchen. Da bin ich gewiss nicht der oder die Einzige.
Max (natürlich hieß er nicht wirklich so) habe ich während meiner dritten Chemotherapie-Woche kennengelernt. Er lag neben mir, an deutlich mehr Messgeräten und Perfusoren angeschlossen als ich - er war schon da, als ich neu in das Dreibettzimmer kam. Oft habe ich nur seine Nasenspitze und seine Stirn gesehen, der schmale, kleine Mann lag meist in den Decken und Kissen verborgen. Aber wir sprachen ab und an miteinander, wie es der Mensch, der einem Leidensgenossen begegnet, eben tut, aus Höflichkeit und einem kleinen bisschen Neugierde - und um vielleicht etwas zu hören, eine Geschichte, eine Erfahrung, ein Detail, das Mut machen könnte. Max war vor seiner Erkrankung Fotograf, ich denke: ein guter, mit künstlerischem Anspruch. Als er erfuhr, dass ich Theologe sei, versicherte er sich, ob ich auch ein »echter« sei, ein Pfarrer nämlich - und richtete sich, als ich bejahte, im Bett etwas auf (was sehr, sehr mühevoll für ihn war und, wie es mir schien, mit Schmerzen verbunden), um mir zu sagen (leise, er sprach immer sehr leise): »Beneidenswert. Wie hilfreich muss das sein, einen Gott zu haben. Das macht's doch irgendwie leichter, wenn du einen hast, zu dem du beten kannst.« Und nach ein paar Sekunden: »Ich kann nicht an Gott glauben - aber manchmal fehlt mir das.«
Wäre da doch jemand, der mich hört. Max konnte das - wie ich damals auch - nur als Wunsch, als Verlangen formulieren. Da fehlte etwas oder eine/r, der oder die nötig gewesen wäre. Viele, die dieses Buch lesen mögen, teilen diese Erfahrung - in bestimmten Zeiten, in Zeiten des Leids, wie es scheint: immer ode
