Suche

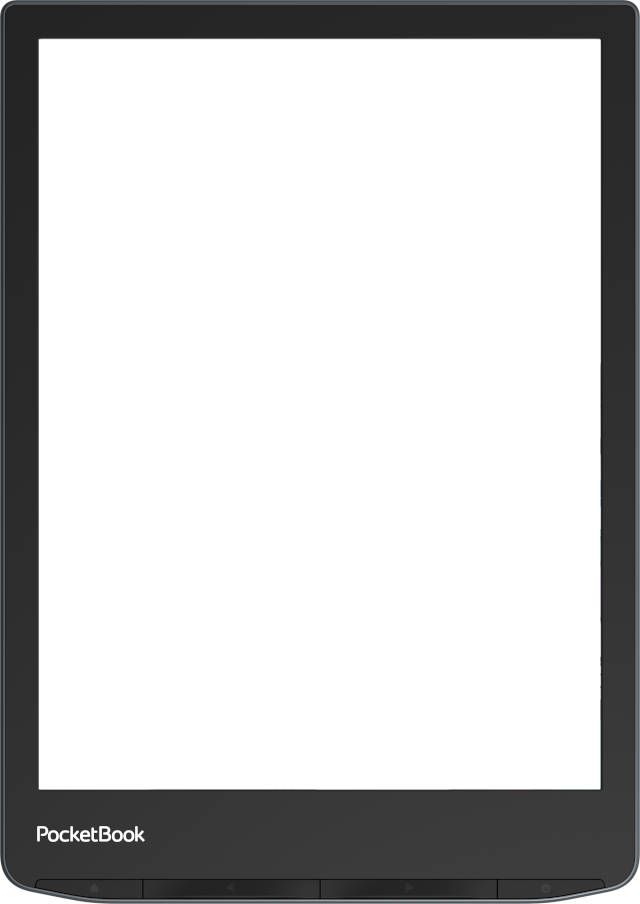
Lückenleben
Mein Mann, der Alzheimer, die Konventionen und ich - Ein SPIEGEL-Buch | Katrin Seyfert
E-Book
2024 Deutsche Verlags-anstalt
256 Seiten
ISBN: 978-3-641-31575-7
in den Warenkorb
- EPUB sofort downloaden
Downloads sind nur in Österreich möglich! - Als Hardcover erhältlich
Vom Umgang mit einem unheilbar Kranken in der Familie und den Erwartungen von außen, die das Leid noch schlimmer machen
Fünf Jahre hat Katrin Seyfert ihren Mann durch seine Alzheimer-Erkrankung begleitet. Anfang 50 war er, als er die Diagnose bekam, Arzt und Vater von fünf Kindern. Sie hat den Familienalltag organisiert, die Finanzen, den Pflegedienst. Schließlich die Beerdigung. Schonungslos offen und brutal ehrlich erzählt sie davon, wie es ist, wenn der Partner allmählich seine Sprache und damit seine Identität verliert. Wie sie mit der Rolle hadert, die ihr erst als pflegende Ehefrau, dann als Witwe zugeschrieben wird. Und wie sie ihren eigenen Weg findet, sich mit der Lücke, die ihr Mann hinterlassen hat, zu arrangieren. Das Leben schlug zu, mit ihren Texten schlägt sie zurück: gegen die Konventionen, gegen die Tabus, gegen die Selbstverleugnung.
Katrin Seyfert ist das Pseudonym einer freien Journalistin, Jahrgang 1971, die in Tübingen Rhetorik und Kulturwissenschaft studiert hat. Sie schreibt u.a. für die ZEIT, die Süddeutsche Zeitung, Eltern und den SPIEGEL, wo sie seit 2019 auch Texte über die Alzheimer-Erkrankung ihres Mannes veröffentlicht, die regelmäßig große Resonanz bei Leserinnen und Lesern hervorrufen. Sie hat sich für ein Pseudonym entschieden, weil die Perspektive der Witwe nur einen Teil ihres Schreibens bestimmt.
Beschreibung für Leser
Unterstützte Lesegerätegruppen: PC/MAC/eReader/Tablet
»Was Sie jetzt brauchen, ist ein Testament«
»Du, Marc, ich möchte für den Spiegel etwas über Alzheimer schreiben. Wäre dir das recht?«
»Für wen?«
»Den Spiegel, das ist die Zeitschrift, die du immer liest.«
»Was ist damit?«
»Ich möchte für den Spiegel eine Geschichte über deine Krankheit schreiben. Würdest du das erlauben?«
»Was?«
»Dass ich eine Geschichte über dich und Alzheimer schreibe.«
»Für wen denn?«
»Den Spiegel.«
»Aha. Und warum?«
An guten Tagen fragt mein Sohn: »Papa, wie heißt die Hauptstadt von Eritrea?«, und mein Mann antwortet: »Asmara. 900000 Einwohner.« Er könnte auch sagen, wie viele Eier eine Mandarinente legt oder was der Unterschied zwischen Zystennieren und Nierenzysten ist. Bei Wer wird Millionär? wäre er weit gekommen.
Vor seiner Krankheit. Vor Alzheimer.
Heute hat er Inseltage. Da ist alles so wie früher. Und Krisentage, da müssen wir mitunter hart verhandeln, damit die Informationen den Kurzzeitspeicher im Gedächtnis wenigstens kurzfristig betreten dürfen. An schlechten Tagen verwehrt die Krankheit ihnen auch gänzlich den Zutritt.
Und ich verfalle nach drei, vier, fünf Wiederholungen in diesen widerlichen Krankenschwesternton, den keine Krankenschwester der Welt benutzt, weil sie Profi ist und ich Amateurin. Ich spreche mit Imperativ-Rhetorik, entbeint von Adjektiven und Adverbien, akzentuiert, unfreiwillig laut und langsam, so als wären Gedächtnisverlust und Schwerhörigkeit ein und dasselbe. »Schrei doch nicht so«, sagt mein Mann, weil das Einzige, was sein Gehirn dann noch wahrnimmt, meine Veränderung in der Modulation ist. Und Veränderung ist bedrohlich.
Angefangen hat die Krankheit kurz nach seinem 50. Geburtstag. Da war es noch keine Krankheit. Sondern ein steter Vorwurf: Kannst du nicht mal den Biomüll ordentlich trennen? Du wolltest doch Brot kaufen, wo ist das denn? Wieso hast du meinen Geburtstag vergessen?
Ich schob es auf die Arbeitsbelastung, obwohl die nur ein Symptom seiner beginnenden Krankheit war. Ich schob es auf eine Depression, obwohl die nur eine Konsequenz unserer Ahnung war. Ich schob es sogar auf unsere drei Kinder, damals zehn, acht, sechs, so laut, so wild, obwohl sie nur eine Ablenkung von der wachsenden Panik waren.
Mein Mann ist Arzt, ich bin sicher, er wusste zu jeder Zeit, dass sich da etwas zusammenbraute, was nicht gut war. Also schob er hinaus und kompensierte. Ich fand immer häufiger Zettel, auf denen Selbstverständlichkeiten standen: »10 Brötchen kaufen«, »Fußballtraining 16 Uhr«. Er schlief vor Erschöpfung bei der Tagesschau ein. Er lachte seltener und trank dafür Kaffee, der Tote hätte wecken können. Später, viel später las ich, dass Kaffee Demenz verlangsamen kann und dass die Verschlechterung des Geruchs- und Geschmackssinns ein Frühsymptom von Alzheimer sein kann.
Aber irgendwann kamen wir an den Tatsachen nicht mehr vorbei. Wir mussten uns anbrüllen, damit etwas in Bewegung kam. Nein, wir redeten nicht gesittet und wie vernünftige Leute. Wir schrien gegen unser beider Vorahnung an. Und ich rang Marc ein Versprechen ab: »Nach den Sommerferien gehe ich zum Arzt.«
Leider sagte er nicht, zu welchem. Und weil er nicht blöd, sondern nur dement wurde, ging er erst einmal zu einem Arzt, der garantiert nichts finden konnte, damit ich wieder für ein paar Monate Ruhe gab: Er ließ seine Lunge röntgen, seinen Bauch sonografieren, seinen Magen-Darm-Trakt spiegeln. Dass er nicht noch nach Senk- und Spreizfüßen schauen ließ, war alles. Heute weiß ich, dass er Zeit schinden wollte vor dem Unabwendbaren. Denn das einzig Sichere an dieser Krankheit ist: Sie schreitet voran.
Gedächtnistest, MRT, eine Liquorpunktion, selbst ein PET-Verfahren, das die Hirnregion radioaktiv anreic
- 2024
- alzheimer
- arno geiger
- bettina tietjen
- biografie
- biographien
- das jahr magischen denkens
- das leben ist ein vorübergehender zustand
- demenz
- der alte könig in seinem exil
- ebooks
- familienleben
- gabriele von arnim
- gesellschaftliche konventionen
- gesundheit
- joan didion
- krankheit
- neuerscheinung
- psychologie
- selbstermächtigung
- trauerbewältigung
- unter tränen gelacht
